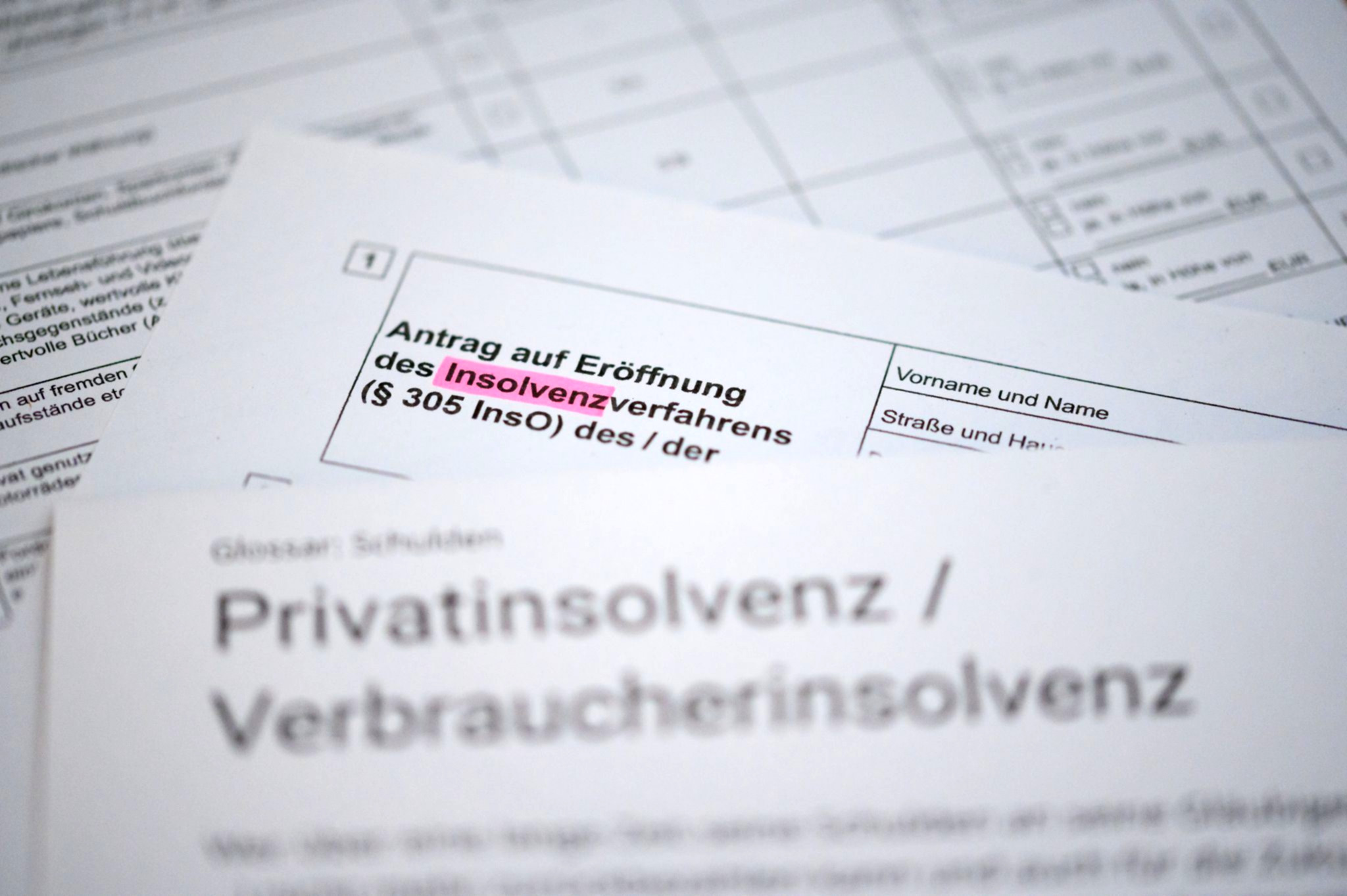Die Anzahl der Menschen in Deutschland, die finanzielle Schwierigkeiten hat, steigt immer mehr. Es gibt viele Ursachen: Angefangene Kosten für das tägliche Leben, Verlust des Jobs, gesundheitliche Probleme, eine Trennung oder einfach die Überforderung mit der Haushaltsführung – all das kann dazu führen, dass man schneller in die Schuldenfalle tappt, als man denkt. In Sachsen-Anhalt ist dieser Trend besonders deutlich zu beobachten, da die Zahl der Insolvenzanträge in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Persönliche Schicksale stehen hinter den nüchternen Zahlen, die eines gemeinsam haben: Die Betroffenen wenden sich immer häufiger an professionelle Beratungsstellen. Aber die Nachfrage übertrifft das Angebot bei weitem, wodurch die Wartezeiten zunehmen und die Fälle komplizierter werden.
Im Jahr 2025 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtert. Steigende Energiepreise, inflationäre Preissteigerungen im Alltag und unsichere Arbeitsmarktbedingungen belasten viele Haushalte zusätzlich. Ungeplante Ereignisse können selbst stabilen Familien den Halt nehmen. Die Beratungsstellen stehen unter enormem Druck, da sie oft die letzte Anlaufstelle sind, bevor Gläubiger, Gerichtsvollzieher oder Versorgungsunternehmen die Situation eskalieren lassen. Ab diesem Zeitpunkt wird es für die Schuldner zu einem Spießrutenlauf durch Ämter, Formulare und Fristen.
Was heißt es, wenn Menschen in die Schulden geraten? Was sind die Gründe für den Anstieg der Insolvenzverfahren? Wie funktionieren Beratungsstellen, und welche Schwierigkeiten haben sie? Welche Aktionen sind effektiv, um den Betroffenen zu helfen? Was können Politik und Gesellschaft tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern? In acht Abschnitten wird die komplexe Thematik behandelt – angefangen bei den Ursachen der Überschuldung, über die Tätigkeit der Beratungsstellen bis hin zu den strukturellen Herausforderungen im Jahr 2025. Es wird offensichtlich: Überschuldung ist kein Randphänomen mehr, sondern ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft und das entschlossen bekämpft werden muss.
Ursachen für den Anstieg der Überschuldung
Verschiedene Faktoren und Ursachen sind verantwortlich für den Anstieg der Überschuldung in Deutschland. Im Jahr 2025 ist die finanzielle Belastung vieler Haushalte das Ergebnis einer Mischung aus makroökonomischen und persönlichen Faktoren. Die kontinuierlich hohe Inflation hat die Kosten für das tägliche Leben deutlich steigen lassen. Vor allem die Kosten für Nahrungsmittel, Mieten und Energie haben in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Haushalte mit geringem Einkommen sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. Ihr finanzieller Puffer ist minimal, was Sie anfällig für unerwartete Mehrausgaben oder Einkommensverluste macht.
Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Wandel der Technologie, Digitalisierung und strukturelle Veränderungen in der Industrie sind Ursachen für Arbeitsplatzverluste oder unsichere Beschäftigungen. Vor allem Personen mit niedrigen Qualifikationen oder in prekären Jobs sind von Arbeitslosigkeit betroffen, die schnell in eine finanzielle Schieflage geraten. Ereignisse wie Scheidung, Trennung oder der Verlust eines Partners können ebenfalls dazu führen, dass das Einkommen stark sinkt, während die Fixkosten gleich bleiben.
Die Einflüsse von Krankheit und Unfall sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Eine längere Arbeitsunfähigkeit führt zu Einkommensverlusten, während gleichzeitig medizinische oder pflegerische Kosten entstehen. So geraten viele Familien in eine Spirale, die aus Zahlungsrückständen und neuen Verbindlichkeiten besteht. Außerdem ist es in einer konsumorientierten Gesellschaft wie der deutschen relativ einfach, Kredite und Konsumfinanzierungen zu erhalten. Eine unzureichende Finanzbildung und die Versuchung, kurzfristige Wünsche auf Kredit zu erfüllen, sind häufige Ursachen dafür, dass Schulden sich anhäufen, die irgendwann nicht mehr bedient werden können.
Ein systemischer Aspekt ist die fehlende Absicherung in den sozialen Sicherungssystemen. Menschen, die Grundsicherung beziehen oder von Transferleistungen leben, sind besonders gefährdet, überschuldet zu werden. In vielen Fällen decken die Leistungen nicht alle notwendigen Ausgaben, besonders wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Immer mehr Menschen sind auf die Hilfe von Schuldnerberatungsstellen angewiesen, um einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden.
Die Entwicklung der Insolvenzverfahren im Jahr 2025
Im Jahr 2025 haben die beantragten Insolvenzverfahren in Deutschland erneut zugenommen. In Sachsen-Anhalt ist diese Entwicklung besonders auffällig; aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes zufolge wurden im ersten Quartal über 20 Prozent mehr Insolvenzanträge im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Ein ähnliches Bild zeigt sich bundesweit: Die Verbraucherinsolvenz, das Verfahren für Privatpersonen, macht weiterhin den Großteil der Anträge aus. Auch die Unternehmensinsolvenzen steigen, vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen, die unter dem Druck steigender Kosten und einer sinkenden Nachfrage leiden.
Um überschuldeten Personen einen schnelleren Ausweg zu bieten, wurde die Regelung zur Verbraucherinsolvenz in den letzten Jahren reformiert. Seit 2023 kann man in drei Jahren seine Restschulden komplett abbauen. Durch die Gesetzesänderung haben mehr Menschen diesen Weg gewählt, anstatt sich jahrelang mit Gläubigern und Inkassounternehmen auseinanderzusetzen. Trotz der Möglichkeit, durch die Insolvenz einen Neuanfang zu wagen, empfinden viele Betroffene den Gang zur Insolvenz als schweren Schritt, der mit Scham und gesellschaftlicher Stigmatisierung einhergeht.
Die zunehmenden Zahlen spiegeln eine gesellschaftliche Entwicklung wider, bei der immer mehr Personen an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit kommen. Die Experten weisen darauf hin, dass die Dunkelziffer noch höher sein könnte, weil viele Überschuldete kein Insolvenzverfahren beantragen. Oft versuchen Menschen zuerst, ihre Probleme alleine zu bewältigen, was die Situation häufig verschlimmert. Sie suchen erst dann professionelle Hilfe, wenn der Druck durch Zwangsvollstreckungen, Kontopfändungen oder die drohende Verlust der Wohnung zu groß wird.
Die Beratungsstellen verzeichnen einen erheblichen Anstieg der Anfragen. Im Jahr 2025 wurden in Sachsen-Anhalt über 3.500 Beratungsfälle abgerechnet. Die Personalkapazitäten können mit dieser Entwicklung kaum Schritt halten. Es ist mittlerweile normal, dass man mehrere Monate warten muss, was die Situation für die Betroffenen zusätzlich erschwert. In den letzten Jahren hat sich die Zeit bis zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens fast verdoppelt. Während man 2019 im Schnitt acht bis zwölf Wochen einplante, sind es jetzt oft bis zu neun Monate, bis alle Formalitäten erledigt sind.
Die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen
Für viele Menschen, die in einer finanziellen Notlage sind, sind Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen die erste und oft auch die letzte Anlaufstelle. Ihre Aufgaben sind breit gefächert: Sie analysieren die persönliche Schuldensituation, verhandeln mit Gläubigern und begleiten den Klienten durch das Insolvenzverfahren. Verschiedene Träger, darunter Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonie und AWO, aber auch Verbraucherzentralen und kommunale Einrichtungen, betreiben die Beratungsstellen.
Im Jahr 2025 werden die Beraterinnen und Berater vor besonderen Herausforderungen stehen. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Ratsuchenden und die Fälle haben sich verkompliziert. Vielmehr haben viele Betroffene nicht nur finanzielle, sondern auch soziale, gesundheitliche oder psychische Probleme. Deshalb ist es für die Berater unerlässlich, neben ihrem Fachwissen im Insolvenzrecht und in der Finanzplanung auch die Fähigkeit zu besitzen, einfühlsam mit Menschen umzugehen, die unter Belastung stehen.
Normalerweise startet die Arbeit mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Alle Dokumente – Kontoauszüge, Mahnungen, Kreditverträge, Lohnabrechnungen und vieles mehr – müssen durchgesehen und strukturiert werden. Häufig haben die Finanzen der Klienten über Jahre hinweg außer Kontrolle geraten, was die Aufarbeitung entsprechend zeitaufwendig macht. Danach werden Lösungsansätze gemeinsam erarbeitet. Umschuldung kann das sein, indem man mit Gläubigern über Ratenzahlungen oder Stundungen verhandelt oder – als letzten Ausweg – ein Insolvenzverfahren vorbereitet.
Ein wesentlicher Aspekt der Beratung ist es, weitere Verschuldung zu vermeiden. Die Berater geben grundlegende Informationen zur Haushaltsführung, assistieren beim Aufbau eines realistischen Budgets und beraten zu Themen wie Versicherungen, Sozialleistungen sowie Energie- und Mietkosten. In akuten Notlagen, wie bei drohender Wohnungskündigung oder Energieabschaltung, bemühen sich die Beratungsstellen, kurzfristig Hilfe zu organisieren. Trotzdem sind sie angesichts der steigenden Fallzahlen und der begrenzten Ressourcen immer mehr gefordert.
Wartezeiten und Kapazitätsprobleme in den Beratungsstellen
Im Jahr 2025 sind die Wartezeiten für Schuldnerberatung aufgrund der hohen Nachfrage erheblich gestiegen. In vielen Teilen Deutschlands, vor allem in strukturschwachen Gebieten wie Sachsen-Anhalt, ist es für Ratsuchende oft so, dass sie bis zu sechs Monate auf einen Erstberatungstermin warten müssen. Im Durchschnitt wartet man bundesweit zwischen acht und zwölf Wochen, aber regional kann es deutlich länger sein. Es gibt zahlreiche Gründe dafür: Die Anzahl der Beratungsstellen hat in den vergangenen Jahren die Anzahl der Ratsuchenden nicht im gleichen Maße erhöht. Häufig bleiben die Personalkapazitäten gleichzeitig konstant oder verringern sich sogar.
Die Komplexität der Fälle ist ein Grund, warum die Bearbeitungszeiten verlängert werden. Eine wachsende Zahl von Klienten hat nicht nur Schulden bei Banken oder Versandhäusern, sondern auch Mietrückstände, unbezahlte Energierechnungen, offene Forderungen beim Finanzamt oder aus Unterhaltsverpflichtungen. Die Bearbeitung dieser Fälle ist aufgrund der notwendigen Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und der damit verbundenen Zeitaufwändigkeit nicht einfach. Darüber hinaus benötigen viele Ratsuchende Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, bei Behördengängen oder im Umgang mit digitalen Anträgen.
Die Träger der Beratungsstellen schlagen seit Jahren die Alarmglocke. Ohne mehr Geld und zusätzliches Personal ist eine Überforderung des Systems gefährdet. In Sachsen-Anhalt stehen im Jahr 2025 2,46 Millionen Euro zur Verfügung, um die Beratungsstellen zu fördern – eine Summe, die angesichts der gestiegenen Nachfrage kaum ausreicht. Von den 24 Beratungsstellen im Land mussten zwei ihre Arbeit einstellen, weil die Finanzierung nicht mehr gesichert ist.
In akuten Notfällen bieten die Beratungsstellen oft kurzfristige Termine an. Fälle, in denen die Wohnung verloren gehen könnte oder bei denen Strom und Gas abgeschaltet werden sollen, haben Vorrang. Trotzdem haben viele, die Hilfe suchen, keine andere Wahl, als monatelang auf Unterstützung zu warten – eine Zeitspanne, in der sich ihre finanzielle Lage und oft auch ihre persönliche Situation weiter verschlechtert.
Der Weg durch das Insolvenzverfahren
Für viele Menschen ist das Insolvenzverfahren der letzte Ausweg aus der Schuldenfalle. Es ist möglich, sich innerhalb von drei Jahren von einem Großteil der Verbindlichkeiten zu befreien. Es ist jedoch ein langer und schwieriger Weg dorthin, voller Hindernisse. Als Erstes ist der Beweis der Überschuldung erforderlich. Alle Gläubiger und Forderungen müssen von den Betroffenen offengelegt werden, was eine umfassende Dokumentation erfordert. Die Beratungsstellen helfen dabei, die Unterlagen zusammenzustellen und den Insolvenzantrag vorzubereiten.
Im Jahr 2025 dauert es bis zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens deutlich länger als in den vergangenen Jahren. Nach den Angaben der Schuldnerberatungen liegt der Zeitraum zwischen der Erstberatung und der Antragstellung im Schnitt bei neun Monaten. Die Gründe dafür sind einerseits die gestiegene Fallzahl und andererseits die zunehmende Komplexität der Sachverhalte. Häufig müssen zusätzliche Informationen eingeholt, Nachweise erbracht oder Rückfragen der Gerichte beantwortet werden.
Nach der Eröffnung des Verfahrens beginnt für die Betroffenen die sogenannte Wohlverhaltensphase. Während dieser Phase müssen sie bestimmte Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel einen Teil ihres Einkommens zur Schuldentilgung nutzen und dürfen keine neuen Verbindlichkeiten schaffen. Nach Ablauf der Frist von drei Jahren, die seit der Reform 2023 gilt, werden die Restschulden erlassen. Für viele ist es ein Neuanfang, doch es bringt auch materielle Einschränkungen und psychischen Druck mit sich.
Die Beratungsstellen haben nicht nur bis zur Antragstellung eine Rolle. Sie stehen den Betroffenen während des gesamten Verfahrens zur Seite, beantworten ihre Fragen, unterstützen sie bei Problemen mit Gläubigern oder dem Insolvenzverwalter und helfen, die Finanzen neu zu ordnen. Um einen Rückfall in die Überschuldung zu verhindern, bieten sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Verfahrens häufig Nachsorge an. Trotz allem ist das Insolvenzverfahren für die meisten ein langwieriger und belastender Prozess, den man ohne professionelle Hilfe kaum bewältigen kann.
Soziale und psychische Folgen der Überschuldung
Überschuldung betrifft weit mehr als nur die Finanzen. Die sozialen und psychischen Konsequenzen für die Betroffenen sind erheblich. Im Jahr 2025 stellen Beratungsstellen fest, dass immer mehr Ratsuchende neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch unter Stress, Depressionen, Angststörungen oder sozialer Isolation leiden. Wenn man die Kontrolle über die eigenen Finanzen verliert, ist es nicht selten, dass man sich schämt, Schuldgefühle hat und das Gefühl, versagt zu haben. Viele ziehen sich zurück, brechen den Kontakt zu Familie und Freunden ab und vermeiden es, offen über ihre Situation zu sprechen.
Die gesellschaftliche Stigmatisierung von Schulden trägt dazu bei, diesen Effekt zu verstärken. Trotz der Tatsache, dass Überschuldung weit verbreitet ist, sehen viele sie immer noch als ein persönliches Versagen. Das macht es für sie schwierig, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine drohende Wohnungsverlust, Zwangsräumung, Strom- oder Gassperren sowie die Furcht vor dem Besuch des Gerichtsvollziehers sind besonders belastend. Oftmals erleiden auch Kinder und andere Familienmitglieder mit, wenn das familiäre Umfeld von Überschuldung betroffen ist.
Aus diesem Grund gehören psychosoziale Beratungsangebote zur Schuldnerberatung dazu. Um den Ratsuchenden ganzheitlich zu unterstützen, arbeiten viele Beratungsstellen eng mit sozialen Diensten, Psychologen oder Suchtberatungsstellen zusammen. Es ist entscheidend, Folgeprobleme wie Obdachlosigkeit, Kindeswohlgefährdung oder Sucht von vornherein zu verhindern. Neben ihrer Expertise in finanziellen Angelegenheiten sind die Beraterinnen und Berater auch wichtige Vertrauenspersonen, die in Krisenzeiten Halt bieten.
Auch die Mitarbeitenden der Beratungsstellen sind stark belastet. Häufig arbeiten sie unter Zeitdruck und mit begrenzten Ressourcen, während sie mit existenziellen Nöten konfrontiert sind. Um die Qualität der Beratung zu sichern und die psychische Gesundheit der Beraterinnen und Berater zu schützen, sind regelmäßige Weiterbildung und Supervision unerlässlich. Die Frage, wie man die Beratungsstellen im Hinblick auf Finanzierung und professionelle Ausstattung nachhaltig unterstützen kann, wird im Jahr 2025 also noch wichtiger.
Präventionsarbeit und finanzielle Bildung
Die Präventionsarbeit ist ein entscheidender Hebel, um Überschuldung zu vermeiden. Im Jahr 2025 wird die finanzielle Bildung immer wichtiger. Die Schuldenfalle betrifft viele Menschen, weil sie die grundlegenden Prinzipien im Umgang mit Geld, Krediten und Versicherungen nicht verstehen. Es mangelt jedoch immer noch an umfassenden Angeboten zur finanziellen Bildung. Im Schulunterricht ist das Thema in den meisten Bundesländern nur selten von Bedeutung, und auch in der Erwachsenenbildung gibt es Nachholbedarf.
Aus diesem Grund setzen die Beratungsstellen mehr auf Prävention. Sie bieten Informationsveranstaltungen, Workshops und individuelle Schulungen an, um Geldmanagement zu lehren. Im Fokus stehen Aspekte wie Haushaltsplanung, der sinnvolle Einsatz von Krediten, der Schutz vor unseriösen Finanzdienstleistern sowie die Rechte gegenüber Gläubigern. Junge Menschen, die zum ersten Mal ein eigenes Konto führen oder einen Kreditvertrag abschließen wollen, werden besonders angesprochen.
Online-Angebote werden immer wichtiger. Mit Online-Plattformen, Apps und Webinaren ist es möglich, Zielgruppen zu erreichen, die bisher kaum Zugang zu Beratungsangeboten hatten. Trotz allem ist der persönliche Kontakt entscheidend, vor allem für Menschen in schwierigen Lebenslagen oder mit geringerer Bildung. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Jobcentern, Sozialdiensten und Firmen ist entscheidend, um die Reichweite der Präventionsarbeit zu vergrößern.
Wie erfolgreich diese Maßnahmen sind, hängt entscheidend davon ab, wie sehr sie akzeptiert werden und ob sie langfristig im Bildungssystem verankert werden können. Die Forderung von Experten ist klar: Finanzielle Bildung sollte ein fester Bestandteil des Lehrplans werden, und Lehrkräfte müssen dafür entsprechend geschult werden. Um die Zahl der Überschuldungen langfristig wirksam zu senken, ist eine bessere finanzielle Allgemeinbildung unerlässlich. Es liegt in der Verantwortung der Politik, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen und die Finanzierung zu gewährleisten.
Politische und gesellschaftliche Herausforderungen im Umgang mit Überschuldung
Im Jahr 2025 wird die Politik und die Gesellschaft vor großen Herausforderungen stehen, weil die Zahl der überschuldeten Haushalte steigt. Die strukturellen Ursachen für Überschuldung – angefangen bei unzureichender sozialer Absicherung bis hin zu mangelnder finanzieller Bildung und Defiziten im Miet- und Arbeitsrecht – sind seit Jahren bekannt, doch man geht nur zögerlich dagegen vor. Die Finanzierung der Beratungsstellen ist vielerorts unsicher, und ihr Angebot variiert stark je nach Region. In ländlichen und strukturschwachen Gebieten fehlen oft wohnortnahe Anlaufstellen.
Es gibt politische Initiativen zur Stärkung der Schuldnerberatung auf Bundes- und Länderebene, aber die Umsetzung geht nur langsam voran. Die Beratungsstellen-Träger verlangen eine langfristige und angemessene Finanzierung, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Es ist auch wichtig, den Zugang zur Beratung zu erleichtern – sei es durch mehr digitale Angebote, Online-Beratungen oder das Reduzieren bürokratischer Hürden.
Ein Umdenken in der Gesellschaft ist notwendig. Es ist wichtig, dass Überschuldung entstigmatisiert wird und als ein Problem anerkannt wird, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Es ist entscheidend, dass Sozialdienste, Schulen, Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam arbeiten, um effektive Präventions- und Interventionsstrategien zu entwickeln. Besonders verletzliche Gruppen wie Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Behinderung brauchen einen besseren Schutz.
Die Lehren aus der Corona-Pandemie und den Wirtschaftskrisen danach haben uns deutlich gemacht, dass es sehr schnell gehen kann, dass große Teile der Bevölkerung in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Im Jahr 2025 zeigt die Überschuldung vieler Menschen eine tiefere soziale Spaltung. Die Politik muss soziale Teilhabe sichern und Armut effektiv bekämpfen. Das beinhaltet auch, die Schuldnerberatung als wichtigen Teil des sozialen Netzes anzuerkennen und zu stärken. Die nachhaltige Bekämpfung der Überschuldung ist eine zentrale Herausforderung für den Staat und die Gesellschaft.